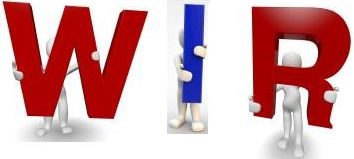Rezidiv oder wir wollen leben – Teil II
Kapitel 8
Wir hatten kaum Zeit, um dunklen Gedanken nachzujagen. Am Montag ging es zum radiologischen Institut. Das bedeutete für mich wieder Warten in verschiedenen Wartebereichen. Zum Ausschluss von Metastasen wurden ein MRT, Knochenszintigramm sowie Ultraschalluntersuchungen der Bauch-Organe durchgeführt. Vor den Ergebnissen dieser Untersuchungen hatten wir beide große Angst. Das Wochenende davor wollten wir niemanden sehen. Wir hätten es nicht ertragen können, wenn jemand gekommen wäre und gesagt hätte: „Es tut mir so leid!“ So gut es auch gemeint ist, Mitleid kann man überhaupt nicht brauchen. Das hätte uns nur aggressiv gemacht. Einige unserer Freunde haben das gut verstanden, andere waren enttäuscht, weil sie sich nur erkundigen wollten, wie es uns geht.
Das Wochenende wurde sehr schön und wir sammelten Kraft, um die Untersuchungen anzugehen. Die Angst vor Metastasen blieb.
Also wartete ich in der gewohnten Weise mit Zeitung und MP3-Player. Das Warten wurde schier unendlich, auch wenn die Untersuchungen lückenlos nacheinander erfolgten. Leider sollten wir alle Ergebnisse erst ganz am Ende bekommen. Nach den Untersuchungen warteten wir auf den Arzt. Die Assistentin empfahl uns, doch einen Kaffee trinken zu gehen. Gute Idee. Wir kamen gerade rechtzeitig, als der Arzt uns ins Besprechungszimmer rief und sagte, man habe keine Metastasen gefunden. Wir jubelten innerlich und gingen fröhlich raus. Erst später wurde uns bewusst, dass es zwar keine Metastasen gab, aber Tina trotzdem wieder Krebs hatte.
Leider gab es im Röntgeninstitut wieder einen bürokratischen Zwischenfall zu meistern:
Die Überweisung für das MRT des Brustzentrums wurde von dem Institut nicht angenommen, da ein MRT nicht nach einer Gewebeprobe gemacht werden dürfte. Aus diesem Grunde musste Tina ein Schriftstück unterschreiben, in dem sie sich verpflichtet, diese Untersuchung privat zu begleichen. Hier war sie wieder die Bürokratie. Wir waren in gutem Glauben mit einer Überweisung hierhergekommen. Nun stellte sich heraus, die Überweisung war nichts wert. Später erfuhr ich, dass es an einer Formulierung lag. Die Ärztin im Brustzentrum hatte als Untersuchungsgrund geschrieben: „Radiologische Abklärung beider Brüste bei gesichertem Krebsbefund in der rechten Brust“ Es hätte aber heißen müssen: „Radiologische Abklärung beider Brüste zum Ausschluss weiterer Rezidive“. Hätten das die überweisenden Ärzte wissen müssen?
Es blieb also unsere Aufgabe, das mit der Krankenkasse zu klären. Es ist ziemlich anstrengend, sich neben dem Kampf gegen den Krebs auch noch um solche Sachen kümmern zu müssen. Was machen eigentliche andere Menschen, die sich nicht so wie wir im System auskennen und keine 450 EURO für eine solche Untersuchung zur Verfügung haben? Sie bekommen das Geld zwar in der Regel wieder. Der Betrag muss aber zuerst vorgestreckt werden. Glücklicherweise half uns eine Sachbearbeiterin der Krankenkasse wieder schnell und unkonventionell.
Weitere Anregungen für optimalere Abläufe:
Ich glaube, dass viele auch gut gemeinte Verbesserungen des Gesundheitssystems beim Patienten gar nicht ankommen, weil die Ärzte nicht genügend informiert sind. Vielleicht liegt es auch einfach an der viel zu großen Bürokratie im Gesundheitswesen. Dies wird zumindest von den Ärzten als Grund angegeben. Aber irgendwie kann ich das in unserem Fall nicht gelten lassen. Hatte die Ärztin im Brustzentrum tatsächlich nicht gewusst, welche korrekte Formulierung sie zur Beschreibung der Untersuchung wählen muss?
Vielleicht hätte sich auch die Verwaltung des Institutes mit der Krankenkasse in Verbindung setzen können, um das Nötige abzuklären. Möglicherweise hätte die Krankenkasse die Rechnung ohne weiteres akzeptiert.
So bedeutete der Vorfall eine zusätzliche Belastung für meine Frau und mich, dabei brauchten wir in dieser Zeit jede nur denkbare Kraft für die Bewältigung der krankheitsbedingten Situation. Es wäre sehr hilfreich und eine große Unterstützung, wenn die medizinischen Einrichtungen und die Krankenkassen in solchen Fällen im Sinne des Patienten unbürokratisch zusammenarbeiten würden.
Kapitel 9
Beim nächsten Besprechungstermin war unsere behandelnde Ärztin leider immer noch in Urlaub. Somit sprach erneut die Oberärztin mit uns. Sie teilte uns mit, was wir schon wussten, dass nämlich keine Metastasen gefunden worden. Danach wurde die weitere Vorgehensweise besprochen. Dabei erklärte uns die Ärztin, dass man mit der Operation die Grundlagen für einen sofortigen Brustaufbau schafft. Es fielen Worte wie Expander und Silikonprothese. Eigentlich ließ sie Tina gar keine richtige Chance, andere Möglichkeiten ins Auge zu fassen. Es wurde noch der Termin besprochen, dann war die eigentliche Veranstaltung vorbei. Da Tina beim Brustaufbau zögerte schlug die Oberärztin vor, sich mit dieser Entscheidung bis zum Morgen der Operation Zeit zu lassen. Eine Alternative sprach sie nicht an. Mögliche Nebenwirkungen beim Brustaufbau wurden überhaupt nicht besprochen. So blieben wir wieder mit einer Entscheidung alleine. Plötzlich stand nicht mehr die bevorstehende Amputation im Vordergrund, sondern nur der Brustaufbau. Wie sollte sich Tina entscheiden?
Beginnt der Brustaufbau direkt nach der Brustamputation bliebe ihr eine Operation erspart. Andererseits könnte sie das auch später noch entscheiden. Die Oberärztin hatte uns nicht sagen können, ob nach der Operation noch eine Chemo erfolgen soll. Sie erklärte uns nur noch, dass es nach der Operation eine Rückfallquote von 5 % gab. Bei meiner Frage, ob beim Brustaufbau sich die Quote erhöhen würde, sagte sie sehr deutlich „Nein“. Somit war meine Entscheidung gefallen. Aber was würde Tina tun?
Eine letzte Frage hatten wir noch, die unseren Urlaub betraf. Sie erklärte uns, dass wir den Urlaub noch nicht stornieren brauchten, da bis dahin noch etwas Zeit sei. Ich hakte nach und wollte das mit der Chemo genau wissen. Sie erklärte daraufhin noch einmal, dass sie zur Chemo nichts sagen könne, da dies erst in einer Tumorkonferenz nach der Operation entschieden würde.
Kapitel 10
Ich hatte nun Angst, dass Tina sich gegen den Brustaufbau entschied und wollte sie mit allen Mitteln dazu überreden. Ich wusste, dass Tina sehr viel Wert auf ihr Äußeres legte und befürchtete, dass sie sich mir gegenüber nicht mehr als richtige Frau fühlen würde. Dabei wäre es mir ganz egal, wenn Tina nur eine Brust hat. Ich liebe Tina und nicht nur ihre Brüste. Ich versuchte ihr meine Einstellung zu vermitteln. Ob sie es mir geglaubt hat? Ich weiss es nicht. Ich glaubte, alles hinge nun von mir ab. Wie konnte ich sie vom Brustaufbau überzeugen? Viele Stunden recherchierte ich in den nächsten Tagen im Internet nach Informationen. Viele Sachen, die ich dort fand, gefielen mir nicht. Ich verschwieg sie. Andere, positive Dinge zeigte ich Tina sofort. Auch unsere Töchter versuchten Einfluss zu nehmen.
Es ging mir dabei nicht um mich Ich wollte nach bestem Wissen versuchen Tina zu unterstützen, damit sie sich psychisch wohl fühlte. Dennoch war ich unsicher und holte mir Rat. Freundinnen und Kolleginnen befragte ich. Richtige und aussagekräftige Antworten bekam ich nie. Zu verschieden waren die Ansichten. Ich fand aber auch keinen Mann, den ich hätte fragen können. Ich blieb allein mit meinen Sorgen. Natürlich hatte ich Bedenken, Tina zu etwas Falschem zu raten. Was geschah, wenn es zu Nebenwirkungen kommen würde, die ich noch gar nicht überblicken konnte? Ich hatte im Internet gelesen, dass der Aufbau insbesondere durch die Expandertechnik auch schmerzhaft sein könnte. Bei dieser Technik schiebt man ein mit Kochsalzlösung gefülltes Silikonkissen unter den Brustmuskel, damit dieser durch Nachfüllen weiterer Flüssigkeit so lange gedehnt werden kann, bis er die Größe der anderen Brust erreicht hat. Sogenannte Kapselfibrosen wurden beschrieben. Hierbei wird die Silikonprothese durch körpereigenes Gewebe fest eingeschlossen. Damit könnten weitere Schmerzen auftreten. Was wäre, wenn es tatsächlich zu diesen Nebenwirkungen kommen würde?
Später sagte mir Tina, sie habe sich schon längst für einen Brustaufbau entschieden. Ich war sehr erleichtert und hoffte, dass dies die richtige Entscheidung sein würde.
Kapitel 11
Am darauffolgenden Dienstag war die stationäre Aufnahme in der Frauenklinik. Es fing schon gar nicht gut an. Tina bekam von einer nicht besonders freundlichen Krankenschwester ein Bett zugewiesen. Sie wollte Tina sofort Blut abnehmen. Da Tinas Venen von der damaligen Chemo kaputt waren, fragte sie, ob das vielleicht besser ein Arzt machen sollte. Es fehlte ein Kopfkissen. Tina nimmt immer ihr eigenes Kissen mit und wir scherzten, dass Patienten der dritten Klasse wahrscheinlich ihr eigenes Bettzeug mitbringen müssen. Wenig später kam eine andere Schwester und führte Tina zum Aufnahmegespräch nach draußen. Später erzählte mir Tina, dass diese Schwester sehr nett gewesen sei und sie gefragt habe, ob man ihr die Station bereits gezeigt habe. Darauf muss Tina wohl scherzhaft geantwortet haben, dass man sich dies wohl bei Patienten der dritten Klasse sparen würde. Kurze Zeit später kam die erste Schwester wieder ins Zimmer und fragte, ob wir mit ihrem Verhalten unzufrieden gewesen wären, weil Tina sich bei ihrer Kollegin doch über sie beschwert habe. Seltsam war das. Tina sagte, dass sie sich nicht über sie beschwert habe und ich fügte hinzu, dass wir so ehrlich seien, jemanden sofort selbst auf seine Fehler hinzuweisen. Da wir das nicht getan hätten, läge auch keine Beschwerde vor. Später erzählte Tina, dass diese Schwester ab sofort nett zu ihr war.
Man erwartete Tina nun im Brustzentrum. Wir trafen noch einmal auf die Oberärztin. Nach nochmaliger Untersuchung teilte Tina ihr die Entscheidung bezüglich des Brustaufbaus mit. Damit war das dortige Gespräch beendet. Nun folgte das Aufklärungsgespräch mit einem Anästhesisten. Dafür mussten wir vor dem Operationssaal warten. Aus dem Besprechungsraum waren laute Stimmen zu hören. Es ging um eine bevorstehende Brustamputation. Dies erboste Tina richtig und sie fragte, warum man die Türe nicht schließen würde. Man könne sich dann ja gleich ein Schild um den Hals hängen, worauf zu lesen wäre: „Meine Brust wird amputiert!“ Tina bat mich, sie zu unterstützen, damit die Tür bei unserem Beratungsgespräch geschlossen wird. Plötzlich kam der Chefarzt des Brustzentrums aus dem Operationssaal an uns vorbei. Wir kannten ihn noch von früher. Tina sagte: „Der sieht richtig fertig und müde aus. Er hatte bestimmt seit dem frühen Morgen nur operiert.“ Ich bewunderte diesen Arzt für seinen großen Einsatz. Dann kamen wir an die Reihe zum Anästhesiegespräch. In dem kleinen und fensterlosen Raum, der die Größe eines begehbaren Schrankes hatte, erwartete uns eine mürrische Anästhesistin. Bevor sie anfangen konnte, klingelte das Telefon. Sie hob ab und beendete das Gespräch mit: „Ich komme“. Sie erklärte uns, dass ein Notfall dazwischengekommen sei, und wir nunmehr wieder warten müssten. Wenig später erschien eine jüngere, wesentlich freundlichere Ärztin und setzte das Anästhesiegespräch mit uns fort. Zurück auf der Station, gab es keine Zeit zum Ausruhen. Es sollte ja noch ein Vorgespräch mit dem Chefarzt stattfinden.
Kapitel 12
Am frühen Abend suchten wir für das Gespräch mit dem Chefarzt noch einmal das Brustzentrum auf. Die Behandlungszimmer des Brustzentrums sind ziemlich kleine Räume ohne Fenster ca. 9 -10 qm groß. Nach einer kurzen Wartezeit wurden wir dann in ein solches Behandlungszimmer geführt, und der Chefarzt erschien mit OP-Schwester, Anästhesistin, Stationsärztin sowie einer Krankenschwester. Das Zimmer war überfüllt. Die vielen Menschen mit weißen oder blauen Kitteln wirkten so bedrohlich wie ein Tribunal. Der Chefarzt ließ sich den Fall schildern. Für ihn war es „der Fall“ und für uns ging es um Tina. Eine seltsame Konstellation und eine schwierige Ausgangssituation für ein gutes Gespräch. Er fragte Tina, ob sie Fragen habe. „Ja“, sagte sie. „Wieso hat man den Krebs erst jetzt gefunden, obwohl ich doch in den letzten 5 Jahren regelmäßig zu den Untersuchungen gekommen bin? Und wieso konnte der Radiologe auch jetzt noch nichts erkennen?“ Man merkte, dass ihm die Antwort schwer fiel. Tina setzte noch einen drauf, in dem sie fragte, wieso das Radiologische Institut bereits im Jahre 2005 vor diffusem Mikrokalk in der Brust gewarnt hatte und keiner im Brustzentrum auf die Warnung eingegangen sei. Ausdrücklich lobte sie unsere Ärztin, weil diese so hartnäckig geblieben sei und damit vielleicht das Schlimmste verhindert hätte. Wir bezeichneten sie als unseren Schutzengel oder Lebensretter. Wir sind ihr dafür ewig dankbar. Der Chefarzt hatte keine Antwort auf unsere Fragen und versuchte dem Gespräch eine neue Richtung zu geben mit den Worten, man müsse nunmehr nach vorne schauen. Er fragte meine Frau, ob sie sich des Risikos des Brustaufbaus bewusst sei, da bei bestrahlter Haut mit einer Kapselfibrose gerechnet werden müsste. Ich fühlte mich, als hätte er mir einen Hammer vor den Kopf gehauen. Tina begann sofort zu weinen. Von Tinas Tränen doch berührt, bat er, sich die Brust einmal anschauen zu dürfen. Er bemerkte, dass Tina die damalige Bestrahlung ohne Verbrennungen gut überstanden hätte und die Haut noch sehr gut aussähe. Dann durfte Tina sich wieder anziehen und verschwand dafür in der Umkleidekabine. Währenddessen raunte der Arzt mir zu, sie solle den Brustaufbau bei diesen guten Hautverhältnissen machen lassen. Ich fragte, warum er das mir und nicht Tina sagen würde.
Noch einmal trat der Brustaufbau in den Vordergrund unserer Gedanken.
Kapitel 13
Tina bekam eine Zimmernachbarin. Anna. Die beiden Frauen mochten sich sofort. War es die gleiche Wellenlänge oder nur das vermeintlich gleiche Schicksal, das sie zusammenbrachte?
Während wir den ganzen Weg zur Station zurück über den Brustaufbau gesprochen hatten, verwickelten wir Anna und ihren Partner in unser Problem. Ich nannte den Partner „Icke“, weil er aus Berlin kommt und vom Wesen und Charakter genauso ist, wie ich mir einen Berliner „Icke“ vorstelle. So ein „Icke“ trägt das Herz auf der Zunge. Typisch „Berliner Schnauze“. Icke hatte einen lockeren Humor, den er auch durch die Krankheits-Situation seiner Freundin nicht verloren hatte. Umso überraschender war es, dass dieser Mensch plötzlich sehr ernsthaft wurde und uns doch bei unseren Überlegungen zur Seite stand. Ich glaube er ist ein toller Mensch, der schon einiges erlebt hat. Seinen Humor hat er dabei nicht verloren. Die beiden waren verliebt wie Teenager. Die Liebe gab Anna Kraft, obwohl sie auch Angst hatte, dass Icke sie nach ihrer Brustoperation verlassen könnte. Offensichtlich hatte sie schon einige Enttäuschungen mit Männern erlebt. Aber ich glaubte, Icke ist anders und trägt sein Herz am rechten Fleck. Die beiden waren ein sehr schönes Paar, ich wünschte ihnen von ganzem Herzen viel Kraft. Ich denke, dass zwei liebende Menschen, die eine solche Krise überstehen, für die Ewigkeit füreinander bestimmt sind. Wenn sie dann noch anderen helfen, sind das wunderbare Menschen, die es verdienen als meine Freunde bezeichnet zu werden. Bei der Auswahl von Freunden bin und war ich immer vorsichtig. Im Laufe der Jahre hatten wir nur eine Handvoll „richtige Freunde“ um uns geschart, obwohl wir einen großen Bekanntenkreis haben. Bei unseren Freunden kann es passieren, dass man lange Zeit nichts voneinander hört und wenn man wieder zusammenkommt, ist sofort alles wie immer. Unsere Freunde versuchten in unserer jetzigen Lage den Kontakt zu uns zu halten, obwohl wir uns ein wenig abgeschottet hatten. Sobald wir ihnen aber unsere Gedanken und Gefühle offenbart haben, verstanden sie es und stehen nun auf Abruf bereit, wenn wir sie brauchen. Wenn Tina wieder gesund ist, werden wir ein großes Fest mit ihnen veranstalten!
Nach einiger Zeit des Plauderns mit Anna und „Icke“ betrat eine junge Stationsärztin das Zimmer und wollte Tina Blut abnehmen. Bei der Blutabnahme fragte sie Tina, wie sie sich entschieden habe. Sicherlich würde sie doch den Brustaufbau machen lassen. Tina erklärte ihr, dass sie grundsätzlich dazu bereit gewesen war, aber durch den Chefarzt sehr verunsichert worden sei. Wir hätten keine Gelegenheit gehabt, unsere Fragen zu diesem Brustaufbau zu stellen. Daraufhin bot sich die Ärztin an, uns entsprechende Antworten zu geben. Endlich gab es jemanden, der uns half in unserer Not. Wir folgten ihr in das Stationsarztzimmer, leider wieder ein Raum ohne Fenster. Ich leide seit meiner Kindheit unter Platzangst und fühle mich in diesen so genannten Besprechungszimmern sehr unwohl.
Aber wir vergaßen die Umgebung und stellten alle unsere Fragen. Geduldig beantwortete uns die Ärztin alles. Nun verstanden wir, wie der Brustaufbau mit einem Expander funktioniert. Sie verschwieg nicht, dass es natürlich auch Nebenwirkungen geben kann. Aber die üblichen Materialien und die besonderen Techniken hätten geholfen, die Nebenwirkungen klein zu halten. Sie wies auch darauf hin, dass die Dehnung des Brustmuskels schmerzhaft ist, dies aber in der Regel später aufhört. Aber viel wichtiger sei die Psyche einer Frau und die Frage, ob sie dies alles auf sich nehmen wolle oder kein Problem damit habe, mit nur einer Brust zu leben. Sie hatte sich bei ihren Erklärungen viel Zeit genommen und damit unwissentlich den Chef des Brustzentrums vor einer schriftlichen Beschwerde bewahrt.
Kapitel 14
Am nächsten Tag war es so weit. Die Operation bzw. Amputation sollte vorgenommen werden. Vor ein paar Tagen war mir ein Zahn abgebrochen. Vor lauter Sorge und Aufregung um Tina hatte ich dies kaum beachtet. So saß ich morgens allein am Frühstücktisch und merkte, wie dieser abgebrochene Zahn doch schmerzte. Da Tinas Operation frühestens um 10.00 Uhr stattfinden sollte, hatte ich noch etwas Zeit. Also rief ich meine Zahnärztin an. Ich schilderte ihr mein Problem. Abgebrochener Zahn, Zahnschmerzen und Sorge um Tina, Zeitnot etc. Als ich ihr vorschlug, am nächsten Tag zu kommen, sagte sie mir, dass sie dann in Urlaub wäre. Was sollte ich nun machen?
Ich wollte doch dabei sein, wenn Tina in den OP geschoben wird. In diesem Zwiespalt war ich nicht mehr in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Entweder zum Zahnarzt oder mit Zahnschmerzen zu Tina. Ich rief Tina an und erzählte ihr meine Not. Wieder zeigte sich Tinas Stärke. Sie schlug mir vor oder besser sie befahl mir, umgehend zum Zahnarzt zu gehen, denn es wäre noch genug Zeit, bis sie operiert würde. Allein hätte ich diese Entscheidung nicht treffen können. Zu groß war der Wunsch bei ihr zu sein, um ihr beizustehen. Und nun war sie für mich da. Es war irgendwie verkehrt. Meine Frau, die eine schwere Operation vor sich und bestimmt große Angst hatte, stand mir in meinem Problem bei und nahm mir meine Entscheidung ab, die ich in diesem Moment alleine nicht hätte treffen können. Ich rief meine Zahnärztin erneut an. Sie bat mich sofort zu kommen. Sie schaffte es, mir ganz schnell zu helfen. In einer halben Stunde war ich aus der Praxis und auf dem Weg zu Tina. Nun klappte alles. Ich fand sofort einen Parkplatz und rannte zur Frauenklinik. Tina war noch im Zimmer. Ich atmete richtig auf. Sie lachte gerade mit ihrer Zimmergenossin Anna. Es war kaum zu glauben, dass beide später operiert werden sollten. Sie erzählten mir von einer netten Krankenschwester. Diese war etwa in unserem Alter und bemühte sich um alle Patienten. Es gibt Menschen, die ihren Beruf als Berufung sehen. Zu diesen Menschen gehörte sie. Sie war immer freundlich, hilfsbereit und erleichterte den Patientinnen durch ihre liebenswerte und auch humorvolle Art den Aufenthalt im Krankenhaus. Plötzlich ging die Zimmertür auf und Tina musste sich auf die Operation vorbereiten, OP-Hemd und die Netzunterhose anziehen und die Beruhigungspille nehmen.
Hätte ich doch auch eine bekommen können. Aber leider gibt es diese Pillen nur für Patienten. Irgendwann wurde Tina abgeholt in den OP. Ich begleitete sie wieder bis zum Aufzug. Dort küsste ich sie und verabschiedete mich. Es war für mich immer ein komisches Gefühl, wenn die Aufzugtür hinter Tina zuging. Ich hatte das schon so oft erlebt. Jedes Mal blieb ich allein mit meiner Angst, dass ich sie niemals mehr wiedersehen würde. Aus diesem Grund war ich bei den letzten Malen auch mitgefahren und habe dann im Vorraum zum OP-Saal gewartet. Aber auch da blieb die Angst. Im Grunde wurde sie dort sogar noch verstärkt, weil es keine Sitzmöglichkeiten gab und man immer auf die Operationssaaltür schaute. Hinzu kam die immer wiederkehrende Diskussion mit OP- Schwestern oder Ärzten, die es nicht so gerne sahen, wenn sich dort ein Unbefugter aufhielt. Dabei war ich nicht unbefugt. Ich war Tinas Mann und hatte jedes Recht der Welt so nah wie möglich bei ihr zu sein. Sie sollte spüren wie nah ich war.
Dieses Mal hatte ich keine Kraft, mich mit den Ärzten und Schwester aus dem OP-Bereich erneut auseinanderzusetzen. Ich beschloss daher, ganz feste an Tina zu denken. Ich hoffte, sie könne spüren, dass ich ihrem Herzen ganz nah bin. Ich fühlte mich mit ihr in diesem Moment sehr verbunden. Tina hatte mir einmal erzählt, dass sie vor der letzten Operation so fest an das Musical „Phantom der Oper“ gedacht hatte, dass sie die Musik tatsächlich hörte. Damit wäre sie ganz ruhig geworden und ihre Angst viel weniger.
Wir haben vor einigen Jahren dieses Musical gesehen. Neben Reisen waren Musicals unsere zweite gemeinsame Leidenschaft. Bereits in jungen Jahren haben wir im Fernsehen keinen Film der Reihe „Des Broadways liebstes Kind“ verpasst. Das Musical „Phantom der Oper“ hatten wir im Kino sowie in einer Aufführung im Musicaltheater Essen gesehen. Die Musik war im Leben zu unserem ständigen Begleiter geworden. In besonderen Stresssituationen konnten wir uns damit beruhigen. Ich wollte ganz nah bei Tina sein. Mir fehlt es an Vorstellungskraft, eine Musik auch in Gedanken zu hören. Ich schaltete also meinen MP3-Player ein und suchte die entsprechende Datei. Als das Musikstück „Maskenball“ kam, fühlte ich mich in den OP-Saal versetzt. Ich sah die Ärzte in ihren grünen oder blauen Kitteln. Ich fühlte keine Angst mehr. Im Geist hielt Tina meine Hand. Ich glaube, ich bin ganz klein und allein ohne sie. Wer mich kennt, wird mir das nicht glauben. Ich wirke nach Außen sehr stark. Tina ist die Einzige, die alle meine Stärken oder Schwächen kennt.
Kapitel 15
Das Warten nahm kein Ende. Ich bin ständig den Flur mit den Kopfhörern meines MP3-Players im Ohr auf und ab gelaufen. Der Flur ist genau 30 Meter lang. Vom Wartebereich zum OP-Aufzug 20 Meter und zum Ausgangsaufzug 10 Meter. Irgendwann ging ich in die Wartezone. Dort saß ein älterer Mann. Er wartete so wie ich auf seine Frau, die ebenfalls operiert wurde. Er saß an einem Tisch in der Mitte des Raumes und löste Kreuzworträtsel der dort herumliegenden alten Illustrierten. Ich weiß nicht, ob es schon jemandem aufgefallen ist, dass Menschen ihre ausgestreckten Beine automatisch zurückziehen, wenn ein anderer vorbeigeht. Dies geschah auch hier. Irgendwann sagte ich ihm, dass ich überhaupt nicht an seine Beine gelangen könnte. So kamen wir ins Gespräch. Es schien so als hätte er nur darauf gewartet, dass ihn jemand ansprechen würde. Er erzählte mir, dass er bereits seit über 40 Jahren mit seiner Frau verheiratet sei. Sie hatte schon mehrere Krebserkrankungen überstanden. Nun bestand ein erneuter Verdacht und die Ärzte wollten eine Gewebeprobe nehmen. Man merkte ihm an, dass er sehr besorgt war, obwohl er immer weiter losplapperte. In kürzester Zeit kannte ich seine Herkunft, seine Arbeit sowie seine gesamten Lebensverhältnisse. Er war sicherlich froh, sich mit jemandem unterhalten zu können. Durch sein ununterbrochenes Reden wurde ich so abgelenkt, dass die Zeit des angstvollen Wartens etwas schneller verging. Allerdings hörte ich mit einem Ohr weiter auf das Klingeln des Stationstelefons. Ich wusste, wenn es klingelte, konnte eine Patientin aus dem OP-Bereich abgeholt werden. Leider wussten auch die Schwestern nie, wen sie abholen mussten.
Anregung zum besseren Ablauf:
Die im OP hätten doch sagen können: „Holen Sie bitte Frau Schmitz oder Frau Meier ab!“. Diese Nachricht hätten die Schwestern dann den Angehörigen weitergeben können.
Dies wäre doch kein großer Aufwand gewesen. Die Angehörigen wären dann doch etwas beruhigter gewesen. Aber wer denkt schon an ängstliche Ehemänner.
Irgendwann wurde dann die Ehefrau meines Gesprächspartners geholt. Nun war er gefordert, seiner Frau etwas zu Essen oder zu Trinken zu geben. Jetzt waren die Angehörigen auf einmal eine große Hilfe, obwohl man sich zuvor überhaupt nicht um sie gekümmert hatte. Irgendwie stören sonst Angehörige den Arbeitsanfall auf einer Station.
Mit Ausnahme von Schwester Manuela. Sie hatte ein Gespür, wenn man sich auch einmal um einen ängstlichen Ehemann kümmern muss. Tina war bereits schon über 4 Stunden weg. Die Krankenschwester spürte meine aufkeimende Unruhe. Irgendwann sagte sie zu mir, dass sie nunmehr eine weitere Patientin abholen müsse. Sie könne mir aber wieder nicht sagen, um welche es sich handeln würde. Ich bat sie doch einmal zu fragen, ob Tina bereits im Aufwachraum sei und ob es ihr gut gehen würde. Ich postierte mich am OP-Aufzug und wartete darauf, dass die Schwester wiederkam. Die Aufzugtür ging auf und sie schob ein Krankenbett heraus. Als sie mich sah, sagte sie, sie müsse gleich eine weitere Patientin mit dem Namen meiner Frau holen. Endlich eine Nachricht. Dann sagte sie, die Patientin, die sie gerade bringen würde, hätte sich mit meiner Frau bereits schon sehr schön unterhalten. Dies bestätigte mir die Patientin. In diesem Moment wusste ich allerdings nicht, dass es Marlene war. Tina hatte Marlene beim Warten auf den Anästhesisten kennen gelernt. Später hatten sie sich auf der Station angefreundet. Nunmehr telefonieren sie hin und wieder miteinander. Marlene erzählte mir auf den Weg in ihr Zimmer, dass es Tina gut gehen würde und sie bereits miteinander gelacht hätten. Da war sie wieder, die von mir so bewunderte Solidarität unter den erkrankten Frauen. Ich glaube, wir Männer sind anders gestrickt. Wir leiden alleine und vor allen Dingen „wir leiden“. In der Zukunft werde ich mir an diesen Frauen ein Beispiel nehmen. Ich glaube, dass auch die Männer zu solidarischem Handeln in einer solchen Situation in der Lage wären, wenn sie über den Schatten ihrer scheinbaren Stärke springen können. Aber zuerst muss mit der irrigen Ansicht aufgeräumt werden, dass jeder Mann ein Alphatier ist und den anderen als potenziellen Konkurrenten sieht. Dies werde ich angehen. Ich werde einen Partnerstammtisch für Partner von an Brustkrebs erkrankten Frauen gründen. Dies hatte ich bereits zuvor mit Renate von der Selbsthilfegruppe „Wir alle – Frauen gegen Brustkrebs“ besprochen. Seit 2004 sind wir Mitglied in dieser Selbsthilfegruppe. Renate ist eine tolle Frau und weis fast immer Rat für ein noch so kleines Problem. Sie lebt diesen Verein und ich glaube, dass sich ihr ganzes Privatleben hiernach richten muss. Von meiner Idee war sie ganz begeistert und wollte mich unterstützen.
Nun sah ich wie die Krankenschwester mit dem Aufzug wieder runter Fuhr. Gleich war es soweit. Tina wird wieder bei mir sein. Mit klopfendem Herzen postierte ich mich erneut vor die Aufzugtür. Es konnte keiner mehr an mir vorbei. Was würde passieren, wenn Tina doch nicht drin wäre. Ich glaube, dann wäre ich selbst in den Aufwachraum gegangen, um sie abzuholen. Ich war überzeugt, dass mich dann keiner hätte aufhalten können. Es ertönte ein Pling und die Aufzugstür ging auf. Ich erkannte sofort die Schwester wieder. Sie schob mit einem breiten Grinsen ein Krankenbett aus dem Aufzug. In diesem Bett lag Tina mit leuchtenden Augen. Ich glaube, sie hat sich genauso gefreut wie ich, als wir uns sahen. Vielleicht sah sie mir auch meine Erleichterung an. Ich konnte sie endlich wieder in den Arm nehmen. Ich half der Schwester Tinas Bett über den Flur in Zimmer zu schieben. Vielleicht hätte sie das alleine besser gemacht. Ich denke aber, dass sie ein Gespür dafür hatte, wann es erforderlich ist, einem Partner das Gefühl zu geben, er würde gebraucht. So eine Krankenschwester war ein Goldstück. Wenn hier mehr von solchen Menschen arbeiten würden, wäre der Aufenthalt der Patientinnen in der Frauenklinik viel angenehmer. Sie wiegen manche Unzulänglichkeit in der Organisation des Klinikalltages auf. Nun konnte ich nur für Tina da sein. Ich holte ihr Tee und besorgte ihr Zwieback. Natürlich hatte sie Schmerzen. Aber sie war so tapfer. Wir lagen uns in den Armen und vergaßen fasst, dass neben uns noch Anna lag, die immer noch auf Ihre OP wartete. Anna war auch tapfer, obwohl sie auch Angst hatte.
Irgendwann kam unsere ältere Tochter Sonja. Sie lebt seit 2 Jahren in einer anderen Stadt im Süden von Deutschland. Als sie von Tinas erneute Erkrankung gehört hatte, hatte sie sich fest vorgenommen, da zu sein, wenn Tina aus dem Operationssaal zurückkommt. Nun kann man nicht so einfach punktgenau aus der Ferne kommen. Sie war auf einen Freund angewiesen, der sie nach Köln mitnehmen wollte. Telefonisch hatte sie mir ständig gesagt, wo sie sich zurzeit auf der Autobahn befindet. Ich war froh, als sie dann endlich da war.
Kapitel 16
Sonja war bei Tinas erster Krebserkrankung im Jahre 2004 zur gleichen Zeit für 3 Monate in Afrika. Dies war schon sehr lange in Ihrem Studium zur Sonderpädagogin geplant. Tina hatte ziemlich hierunter gelitten. Oft hatte sie Angst, dass sie sterben würde ohne Sonja wieder zu sehen. Sehr oft habe ich mit viel Druck auf Tina versucht, einen aufkeimenden Konflikt zwischen den beiden zu unterdrücken. Heute weiß ich, dass das falsch war. Der Konflikt hätte ausgetragen werden müssen. Ich glaube, es waren sehr viele Verletztheiten vorhanden, die nicht überwunden werden konnte, weil ich die notwendige Auseinandersetzung vor Angst einer Spaltung unserer Familie immer unterdrückt habe. Heute weiss ich, dass wir zur Bewältigung dieses Problems psychologische Hilfe benötigt hätten. Ich fand es nun einfach schön, dass Sonja nunmehr so spontan kam. Sie war mir dann eine sehr große Hilfe. Es war schon ein komisches Gefühl, da kam nicht mehr ein kleines Kind, sondern eine erwachsene Frau. Sie entwickelte sofort eine zupackende Art. Schließlich ist sie Tinas Tochter. Ich konnte Tina ansehen, dass sie sich unheimlich gefreut, hatte, als sie Sonja sah und umarmen konnte. Wir lachten zu dritt und erzählten viel. Fast hatten wir vergessen, dass Tina frisch operiert war. Irgendwann haben wir uns von Tina verabschiedet und sind nach Hause gefahren. Ich konnte das in dem Bewusstsein tun, da ich wusste, dass Tina die Operation nun zu mindestens körperlich gut überstanden hatte. Zu Hause haben Sonja und ich uns auf unseren Balkon gesetzt und viel miteinander geredet. Es ging um die Aufarbeitung von damals, über meine und ihre Gefühle. Irgendwann hatten wir aber auch Zeit, uns über die Gegenwart zu unterhalten. Sie erzählte mir von ihrem Leben in der anderen Stadt, über ihre Arbeit und ihrer Beziehung zu ihrem Freund. Es war sehr schön, mal etwas anderes als Krebs zu hören. Dieser Krebs hatte doch einen sehr großen Teil meines Lebens eingenommen. Ich war nicht mehr wichtig. Mein nicht besonders guter körperlicher Zustand spielte keine Rolle mehr. Ein paar Monate zuvor hatte ich so starke Rückenschmerzen, dass ich kaum laufen konnte. Ich war nunmehr in ärztlicher Behandlung. Diese Behandlung war aber durch Tinas Erkrankung ganz in den Hintergrund geraten. Ständig musste ich irgendwelche Termine absagen. Ich brauchte sie aber auch nicht, da ich meinen Körper eh´ nicht fühlte. So groß waren meine Sorgen um Tina. Nun war Sonja da und ich genoss die Unterstützung durch sie. Ich wusste, dass Sonja ihre Mutter im Krankenhaus auch besuchen würde, wenn ich arbeiten musste. Auch unsere jüngere Tochter Sarah war nun da. Es ist schön, so große Töchter zu haben. Ich bin richtig stolz auf sie. Am nächsten Tag ging ich ins Büro. Es war sehr viel Arbeit liegen geblieben. Von dort aus telefonierte ich zwischendurch auch mit Tina. Dabei teilte sie mir ziemlich fröhlich mit, dass es aufgrund des angefangenen Brustaufbaus alles nicht so schlimm aussah, wie wir uns es vorgestellt hatten. Ich glaubte nun, dass wir den Rest auch schon schaffen werden. Dass dieser Rest noch sehr viel war, konnte ich damals nicht ahnen. Mittags fuhr ich dann direkt von Siegburg ins Krankenhaus und fand Tina mit Sonja gut gelaunt vor. Ich freute mich sehr darüber. Später ging Sonja, weil sie noch einige alte Studienfreunde treffen wollte. Nun war ich mit Tina alleine oder doch nicht. Da gab es noch die Zimmernachbarin Anna. Beide Frauen hatten sich doch sehr angefreundet und schmiedeten bereits Pläne für die Zeit nach dem Krebs. Anna führte einen kleinen Ort in der Eifel ein Museumscafe. Da Tina ihr erzählt hatte, dass sie malte, schlug Anna eine Ausstellung mit Tinas Bilder in ihrem Cafe vor. Ich fand dies eine gute Idee. Vielleicht war das ein erster Schritt zur Heilung. Als unsere jüngste Tochter ausgezogen ist, haben wir aus ihrem Zimmer ein Malzimmer eingerichtet. Seit dem malte Tina. In der Zeit der neuen Brustkrebserkrankung bemüht sie sich die Krankheit in ihren Bildern aufzuarbeiten. Ich finde ihre Bilder sind sehr schön und aussagekräftig. Sie sollte tatsächlich, ihre Bilder einmal einer Öffentlichkeit zeigen. Anna hatte einige Bilder gesehen, die ich auf Tinas Handy gespeichert hatte. Sie hatte auch etwas Ahnung von Malerei, da sie einer Künstlergruppe in Blankenheim angehört und schon einige Ausstellungen hinter sich hatte. Umso bemerkungswerter war es auch, dass sie Tina ein solches Angebot machte.
Irgendwann kam Icke. Es war eine schöne Zeit, die wir vier in diesem Krankenzimmer verbrachten. Es war eine noch nicht so oft erlebte Harmonie zwischen unterschiedlichen Menschen, die sich kaum kannten. Tina erzählte mir noch vom Chefarzt, der er am nächsten Tag wie ausgewandelt gewesen sei. Er sei sehr nett gewesen und hatte meiner Frau gesagt, sie hätte sich mit dem Aufbau richtig entschieden. Ich dachte nur, warum nicht gleich so. Irgendwann werde ich ihn einmal darauf ansprechen. Aber das kommt später.