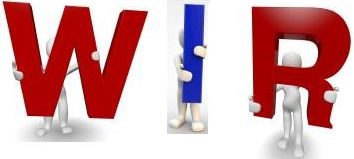Rezidiv oder „wir wollen leben“ – Teil I
Prolog
Dieses Buch widme ich allen starken Frauen, die an Brustkrebs erkranken und dagegen kämpfen. Durch den engagierten Einsatz einer Vielzahl von Ärzten, Selbsthilfegruppen, Politikern und Prominenten hat sich in der Behandlung und Betreuung von Brustkrebspatientinnen in den letzten Jahrzehnten viel getan. Das Screening bzw. Reihenvorsorgeuntersuchungen wurden eingeführt, Kliniken wurden in ihrer Ausstattung besser auf die Belange der Frauen abgestimmt und Therapien haben sich wesentlich verbessert. Auch die menschliche und psychologische Betreuung der Betroffenen hat sich zum Positiven entwickelt. Dennoch bleibt noch viel zu tun.
Brustkrebspatientinnen und deren Angehörige stehen nicht nur vor der Herausforderung, der Krankheit zu begegnen, sondern sich auch der Auseinandersetzung mit dem Gesundheitssystem zu stellen.
Ich möchte aus meiner persönlichen Sicht als Partner einer Brustkrebspatientin und sehr starken Frau von meinen Eindrücken und Erfahrungen während der Erkrankungs- und Therapiezeit und der Bewältigung der Erkrankung berichten.
Somit widme ich dieses Buch auch meiner Frau Tina, mit der ich über 30 Jahre sehr glücklich verheiratet bin.
Kapitel 1
Im Jahre 2004 erkrankte meine Frau Tina erstmalig an Brustkrebs. Ich erinnere mich noch sehr gut, als sie bleich aus der Dusche kam und den Knoten in ihrer Brust ertastet hatte. Alles ging dann sehr schnell. Direkt am nächsten Tag begleitete ich sie zur Frauenärztin und Tina wurde sofort in das Brustzentrum einer großen Klinik überwiesen. Von dort wurden wir zu verschiedenen Ärzten und Diagnostikern geschickt, die zu dem Ergebnis kamen, dass es sich um einen bösartigen Tumor handelte. Da der Tumor bereits sehr groß war, empfahlen die Ärzte im Brustzentrum zunächst eine Chemo-Therapie um den Tumor zu verkleinern und danach Brust erhaltend operieren zu können. Nach ca. einem dreiviertel Jahr waren alle Therapien, einschließlich Bestrahlung absolviert und Tina galt als geheilt.
Es blieb die Angst, dass der Krebs wiederkommen würde. Sie begegnete damals im Krankenhaus und bei der Chemo vielen Frauen, die sich selbst humorvoll „Wiederholungstäter“ nannten.
Was die latente Angst betrifft, erinnere ich mich besonders an eine Begebenheit.
Tina hatte einen Termin zur Nachuntersuchung und war mit unseren beiden Töchtern unterwegs. Die drei wollten nach dem Termin einen schönen Nachmittag in der Stadt verbringen und shoppen gehen. Ich bekam plötzlich einen Anruf im Amt, wobei Tina mir unter Tränen mitteilte, dass man wieder etwas gefunden habe. Schnell hatten wir wieder einen Termin im Brustzentrum. Dort gab man uns Entwarnung. Der dortige Radiologe hatte sich alle Röntgenbilder nochmals angeschaut und kam zu dem Schluss, dass es ein Fehlalarm war.
Ich hatte diese Episode schnell verdrängt. Wir wollten leben und noch viele Dinge tun, die nicht möglich waren, als unsere Töchter klein waren. Hierzu gehörten auch Reisen in fremde Länder. Kurze Zeit nach diesem Zwischenfall sind wir im Alter von 45 Jahren das erste Mal geflogen. Es war ein tolles Gefühl, auch wenn Tina immer Angst hatte, abzustürzen. Sie hätte doch nicht den Krebs überlebt, um dann mit einem Flugzeug auf dem Meeresgrund zu liegen, sagte sie. Aber das hat sie nie so richtig ernst gemeint. Sie genoss unsere Reisen. Wir waren in einem neuen Lebensabschnitt angekommen. Unsere Töchter lebten bereits selbstständig und wir freuten uns über unsere wieder gewonnene Freiheit. Obwohl wir in all den Jahren mit unseren Kindern nie aufgehört haben, ein Paar zu sein. Wir hatten keine Schwierigkeiten, uns wieder auf unsere Zweisamkeit umzustellen. Im Gegenteil! Wir kamen uns wieder wie verliebte Teenager vor, die die Liebe und den Partner neu entdeckten.
Kapitel 2
Nach unserem letzten Frühjahrsurlaub stand die routinemäßige halbjährliche Nachuntersuchung auf dem Plan. Wie üblich versuchte ich, Tina ins Brustzentrum zu begleiten. Sie sagte, ich würde ihr immer Glück bringen. Aber dieses Mal war alles anders. Bereits vor einem Jahr hatte man bei einer Mammografie erneut Mikrokalk entdeckt. Allerdings wertete der Radiologe dies als nicht besonders schlimm. Tina bestand dennoch, auch unter Widerstand der Ärzte, auf einer Biopsie. Die Untersuchung blieb ohne Befund. Unser Leben verlief normal weiter. Tinas Angst war unbegründet gewesen. Die Ärzte hatten Recht behalten. Hinterfragt haben wir nichts mehr, auch als sich an Tinas Brust Veränderungen zeigten. Die Brustwarze zog sich zurück. Gerne hörten wir die Erklärung, dass hierfür wahrscheinlich die Stanzbiopsie verantwortlich sei.
Nun saßen wir wieder im Brustzentrum und warteten auf unseren Termin. Das Brustzentrum wurde zu dieser Zeit umgebaut. Alles war noch sehr provisorisch. Die Neueröffnung sollte vier Wochen später stattfinden. Als uns endlich eine Ärztin aufrief, waren wir guter Dinge und scherzten mit ihr. Wir kannten sie schon eine Weile. Als sich Tina auszog, sah ich der Ärztin an, dass sie über die Form von Tinas Brust erschrak. Nun sprudelte es auch aus Tina heraus. Sie habe schon lange Angst gehabt, dass da wieder etwas sei. Die Ärztin fragte uns, wann wir den Termin zur Mammografie hätten. Wir organisierten es immer so, dass beide Termine im Brustzentrum, sowie in der Radiologie der Klinik am gleichen Tag waren. Die Ärztin bat uns dem Radiologen auszurichten, dass er sie umgehend nach der dortigen Untersuchung anrufen solle. Mit großer Sorge machten wir uns auf den Weg zur radiologischen Abteilung ins Hauptgebäude des Krankenhauses.
Kapitel 3
Diesen Weg waren wir in den letzten 5 Jahren schon oft gegangen. In der Radiologie wurde Tina nach kurzer Zeit zur Mammografie gerufen. Mein Part war wie immer bei solchen Untersuchungen das Warten. Dabei hatte ich schon eine gewisse Routine entwickelt. In der Regel las ich eine Zeitung und hörte Musik über meinen MP3-Player. Meist schaffte ich es in dieser Zeit, alle Zeitungsartikel zweimal zu lesen. Auch die Artikel, die mich nicht besonders interessierten, studierte ich in solchen Wartezeiten aufmerksam. Diesmal war ich aber besonders unruhig und konnte mich nicht auf das Lesen konzentrieren. Selbst die Musik und das Radio-Gequassel aus meinem Mp3-Player nervte. Das Warten wurde langsam zur Qual. Ich malte mir aus, dass Tina bereits eine schlimme Nachricht erhalten habe und weinend zusammengebrochen sei. Dabei säße ich nur hier rum und könnte nicht bei ihr sein.
In solchen Situationen spüre ich sehr deutlich meine Hyperaktivität. Niemand hatte mir jemals gesagt, dass ich hyperaktiv bin. Als ich jung war, kannte man diesen Begriff überhaupt nicht. Erst bei meiner jüngeren Tochter wurde ein solcher Verdacht geäußert. Sie war schon als Kleinkind unheimlich lebhaft. Manche Nächte hatte es gekostet, wenn sie in tiefster Nacht, neben meinen Bett eine Kiste mit Duplosteinen ausschüttete oder meine Augenlieder aufzog und sagte: „Papa spielen.“ Wenn ich mich manchmal bei meiner Mutter darüber beklagte, lachte sie und beschrieb, wie ich als Kind gewesen sei. Heute ist unsere Tochter 23 Jahre alt und hat sich zu einer wunderbaren jungen Frau entwickelt. Ich bin sehr stolz auf unsere beiden Töchter.
Mittlerweile weiß ich, dass auch ich ganz schön Stress verbreiten kann. Obwohl ich glaube, dass ich mich in der Regel ganz gut im Griff habe. Tina lebt allerdings schon so lange mit mir. Manchmal ist sie sehr genervt, findet meine Lebendigkeit aber auch schön. Schließlich sei es nicht langweilig mit mir.
Ich tigerte also unruhig im Wartezimmer der Radiologie hin und her. Endlich kam Tina und sagte, sie müsse noch auf das Ergebnis warten. Kurze Zeit später wurden wir wieder aufgerufen. Ein freundlicher Arzt erklärte uns die Aufnahmen der Mammografie und deutete auf eine kleine Mikrokalkgruppe. Nach seiner Meinung bedeutete das nichts Schlimmes. Bei Tina läuteten die Alarmglocken. Mikrokalk gleich Krebs! Eine solche Diagnose wurde bereits 2004 bei der ersten Erkrankung gestellt. Danach war schließlich der bösartige Tumor entdeckt worden.
Der Radiologe beruhigte sie nochmals und sagt zu, sofort die Ärztin im Brustzentrum anzurufen. Wir machten uns auf den Rückweg.
Kapitel 4
Noch einmal Warten im Brustzentrum. Schließlich rief uns die Ärztin ins Sprechzimmer. Sie erklärte uns, sie habe mit dem Radiologen gesprochen und dieser sei nach Rücksprache mit seinem Chef zum Ergebnis gekommen, dass im Vergleich zum Vorbefund keine Änderung eingetreten sei. Das verschaffte nicht wirklich Erleichterung. Wenn der Vorbefund bereits schlecht gewesen war, bedeutet keine Änderung auch nichts Gutes. Auch die Ärztin zweifelte an der Meinung ihres Kollegen. Sie war beunruhigt durch die Veränderung der Brust und das uneindeutige Ergebnis der Ultraschalluntersuchung. Sie schlug vor, entweder ein MRT oder eine Stanzbiopsie zur weiteren Abklärung zu machen. Auch eine weitere Beobachtung und ein weiterer Termin nach 3 Monaten wäre möglich, umso wichtiger wäre dann aber eine der genannten Untersuchungen.
Zu meinem Erstaunen entschied sich Tina dafür zu „warten“. Ich verstand in diesem Moment die Welt nicht mehr. Meine sonst so besorgte Tina will 3 Monate warten? Gerne hätte ich sie noch im Beisein der Ärztin zu einer der genannten Untersuchungen überredet. Aber meine Frau hatte sich anders entschieden. Trotzdem fragte ich sie, wieso sie eine solche Entscheidung getroffen habe. Die Antwort war kurz und überzeugend. „Ich habe Angst vor dem Ergebnis und wir wollen ja schließlich noch in Urlaub fahren!“. Genau 3 Tage später rief Tina mich plötzlich im Büro an und sagte, dass die Ärztin sich gemeldet habe. Sie hätten sich auf eine große Gewebeprobeentnahme unter Vollnarkose geeinigt. Irgendwie war ich erleichtert über diese Entwicklung. Seit dem Gespräch im Brustzentrum war ich sehr beunruhigt.
Kapitel 5
Am Mittwochmorgen begleitete ich meine Frau wieder zur Frauenklinik. Im Brustzentrum sollte für den Operateur unter Ultraschall eine Drahtmarkierung gelegt werden. Damit erkennt man während der Operation besser, wo die Gewebeprobe entnommen werden soll. Wir wurden nicht von „unserer“ Ärztin, sondern einer Oberärztin empfangen. Sie erklärte schnell, dass ihre Kollegin Urlaub habe und sie beauftragt worden sei, die Markierung vorzunehmen. Deutlich spürten wir ihre Zweifel an der Richtigkeit des bevorstehenden Eingriffes. Erneut waren wir verunsichert. Aber wir vertrauten dem Urteilungsvermögen unserer Ärztin. Deshalb hörten wir den Worten der Oberärztin nur noch halb zu.
Danach gingen wir auf die Station, wo Tina auf den bevorstehenden Eingriff vorbereitet wurde. Wieder hieß es Warten! Irgendwann kam sie dann schließlich an die Reihe. Ich verabschiedete sie am Aufzug, der die Station direkt mit dem OP- Bereich verbindet.
Im Jahre 2004 bin ich noch mitgefahren und habe im Vorraum zum Operationssaal gewartet. Damals habe ich dort schon große Verwirrung ausgelöst, weil sich das OP-Personal bei meiner „Belagerung“ unwohl und beobachtet gefühlt hatte. Alle Versuche, mich zu verscheuchen, waren damals gescheitert. Als Tina Anfang 2009 eine Gewebeprobe aus der Gebärmutter entnommen wurde, um einen Gebärmutterschleimhautkrebs auszuschließen, war ich noch einmal so beharrlich. Auch bei dieser Belagerung hatten die Ärzte und Schwestern vergeblich versucht, mich hinaus zu komplimentieren. Ich wollte einfach ganz nah bei Tina sein! Das Ergebnis war damals übrigens Gott sei Dank ohne Befund.
Dieses Mal wartete ich auf der Station. Warten, warten, warten! Immer warten! Es gibt nichts Schlimmeres als Warten. Zuerst haben wir gewartet, bis Tina operiert wird. Dann habe ich gewartet, dass sie heil zurückkommt. Nun warteten wir auf die Ärztin, damit sie uns die ersten Eindrücke mitteilt. Zum Schluss wartet man darauf, dass man nach Hause darf. Aber das Warten ist dann immer noch nicht zu Ende. Jetzt kommt die schlimmste Zeit, das Warten auf das Ergebnis. Man hatte uns versprochen, dass dies in ca. 10 Tagen vorliegt und wir telefonisch Nachricht erhalten würden.
Kapitel 6
Zwei Wochen vergingen. Jeden Tag warteten wir in angstvoller Anspannung auf den angekündigten Anruf. Ob Ärzte eigentlich wissen, was das Warten für Patienten bedeutet, über denen das Damoklesschwert einer schlechten Diagnose schwebt? Liegt es an der zu knapp bemessenen Zeit der Ärzte? Vielleicht gibt es auch einfach nicht genügend Personal? Es wird immer sehr professionell gehandelt, aber ich denke, vor lauter Professionalität und Zeitknappheit bleibt die Menschlichkeit auf der Strecke.
Schließlich haben wir dem Warten ein Ende gesetzt und selbst in der Klinik angerufen. Eine freundliche aber leicht genervte Sekretärin teilte mit, dass der Bericht des Pathologen bereits auf dem Tisch der Ärztin läge und diese uns anrufen wolle. Am späten Vormittag kam dann endlich der Anruf und wir bekamen am nächsten Tag um 17:30 Uhr einen Termin. Nach dem Ergebnis gefragt, teilte sie mit, sie dürfe am Telefon hierüber keine Auskunft geben. Vielmehr müsste das in einem persönlichen Gespräch besprochen werden. Die Beunruhigung blieb also! Meine Frau rief mich an der Arbeit an und berichtete mir aufgeregt diese Neuigkeit.
Ich setzte mich sofort mit dem Brustzentrum telefonisch in Verbindung und verlangte energisch, dass der Bericht umgehend an Tinas Frauenarzt gefaxt würde, damit dieser uns das Ergebnis erklären könne. Tinas Schwester arbeitet bei einem Frauenarzt, der nun auch Tina betreut. Wir hatten sie ermuntert dorthin zu wechseln, weil sie mit der Nachsorge der vorherigen Frauenärztin nicht zufrieden war. Der Wechsel stellte sich als glücklicher Umstand heraus, weil der neue Frauenarzt früher auch in einem Brustzentrum tätig war und sich daher gut auskannte.
Wir wurden sehr liebevoll empfangen und der Arzt erklärte uns in aller Ruhe den Befund. Er machte keinen Hehl daraus, dass Tina die Brust verlieren wird. Aber genau diese Ehrlichkeit haben wir gebraucht. Mit der Wahrheit kann man besser umgehen als mit einer Ungewissheit. Nicht nur wir scheinen das so zu empfinden. Bisher haben wir nur Patientinnen getroffen, die sich klare Aussagen wünschen.
Anregungen für bessere Abläufe:
Möglicherweise scheuen sich Ärzte hin und wieder, ihren Patienten die Wahrheit zu sagen. Wenn Ärzte das nicht können, sollten sie sich von einem Psychologen unterstützen lassen. Vielleicht wäre es eine Idee, psychologische Unterstützung im Brustzentrum direkt zu integrieren, damit Patientinnen und Angehörige die Übermittlung von schlechten Nachrichten besser verarbeiten können.
Darüber hinaus sind Andeutungen am Telefon und dann ein Vertrösten auf einen späteren Termin für die Psyche einer Patientin und deren Angehörige das Schlimmste, was man machen kann. Auch Warten lassen, weil der Arzt keine Zeit zum Telefonieren oder für einen Termin hat, ist nicht hilfreich. Ich wünschte mir vor allen Dingen Ehrlichkeit. Ich sehe die Verfahrensweise des Telefonierens überhaupt kritisch. Es ist sicher ungünstig, ein Ergebnis am Telefon zu bekommen. Allein die Nachricht, dass das Ergebnis vorliegt, ist eine große Belastung für den Patienten. Natürlich will er dann das Ergebnis sofort wissen. Bekommt er dann den Hinweis, dass dies nur in einem persönlichen Gespräch zu klären sei, kommt er nicht mehr zur Ruhe. Meines Erachtens gäbe es dafür eine einfache Lösung. Man bestimmt bereits im Vorfeld einen Besprechungstermin. Erfahrungsgemäß könnte dieser nach zwei Wochen vereinbart werden. Sollten Ärzte und Pathologen die Ergebnisse bis dahin noch nicht zusammengestellt haben, kann der Termin telefonisch verschoben werden.
Kapitel 7
Wir fuhren zum vereinbarten Termin ins Brustzentrum und warteten auf die Befundbesprechung. Wieder warten, lange warten! Zwischenzeitlich hatte sich das Erscheinungsbild des Brustzentrums verändert. Der Wartebereich befand sich jetzt im Durchgang zur frauenärztlichen Notfallambulanz sowie zum Operationsbereich. Mit Raumteilern wurde versucht, den wartenden Patienten etwas Schutz zu geben. Ich empfand das allerdings eher bedrohlich als schützend, zumal wir zur abendlichen Stunde alleine dort warteten.
Wir fühlten uns von jedem Vorbeigehenden beobachtet. Und es gingen viele vorbei. Gott sei Dank waren wir bereits von unserem Frauenarzt über den schrecklichen Befund informiert worden. Wir hätten hier voller Angst gesessen. Man kam sich sowieso bereits vor, als wäre man als Homo-Krebsiensis im Zoo ausgestellt. In mir stieg Wut hoch. Gern hätte ich der nächsten vorübergehenden Person gesagt: „Meine Frau ist an Krebs erkrankt, bitte kein Mitleid und vor allem nicht füttern.“ Obwohl wir pünktlich waren, mussten wir noch eine ganze Stunde warten. Dann war es soweit.
Die Oberärztin entschuldigte sich bei uns mit den Worten, dass sie die Zeit genutzt habe, um notwendige Telefonate zu führen. Erst schaute sie sich Tinas operierte Brust an und sagte, es sähe alles sehr gut aus und die Narbe würde schön verheilen. Es klang wie Hohn für uns, weil wir ja schon wussten, dass genau diese Brust amputiert werden sollte. Ungeduldig versuchten wir das Gespräch auf den pathologischen Befund zu lenken. Aber sie brachte die Untersuchung gründlich zu Ende. Danach kam sie auf das eigentliche Thema zu sprechen. Sie erklärte uns, dass der neue Brustkrebs nunmehr ein Rezidiv sei und nicht mehr hormonabhängig wäre. Dabei teilte sie die Auffassung unseres Frauenarztes, dass die Brust amputiert werden muss. Zuvor sollte aber noch abgeklärt werden, ob sich bereits Metastasen gebildet hätten. Sie wies die Sekretärin an die entsprechenden Termine mit einem Radiologen zu machen und schrieb uns einige Überweisungen für die Untersuchungen. Damit war das Gespräch mit ihr beendet.
Im Hinausgehen fragte ich sie, ob es sich bei dem Wartebereich um eine provisorische Lösung handeln würde. Sie zeigte wenig Verständnis für meine Frage. Die Trennwände wären doch schließlich von einem berühmten Designer erstellt worden und sehr teuer gewesen. Man hätte sich viele Gedanken hierüber gemacht. Es wäre doch schön hell und anders als noch im alten Wartebereich ohne Fenster. Man könne ja auch zum Warten in den Garten gehen. Wer wird das wirklich tun, wenn er so wie wir auf einen schrecklichen Befund wartet. Ich konnte ihr nicht deutlich machen, dass wir das ganz anders empfunden haben. Sie war zu sehr von der jetzigen Lösung überzeugt.
Wir gingen in das Büro der Sekretärin und bekamen die Termine in einer radiologischen Praxis außerhalb der Klinik. Die Sekretärin erklärte mir, dass das Brustzentrum nicht mehr offiziell zum Krankenhaus gehöre, sondern nunmehr ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Klinik sei und damit eigenständig zum Wohl der Patienten arbeiten könnte. Man könne nunmehr viel flexibler handeln und damit auch schneller Termine bei Partnerärzten bekommen.
Wir waren nicht böse darüber, nicht mehr in die radiologische Abteilung der Klinik gehen zu müssen. Wir haben immer noch den Verdacht, dass dort das Rezidiv jahrelang übersehen worden ist. Unsere seelische Verfassung fand im Brustzentrum wenig Beachtung. Einzig von der Sekretärin kam etwas Wärme herüber. Sie verstand auch unsere Bemerkungen über den Wartebereich.
Nun war es passiert, wir hatten es amtlich, schriftlich und mit Siegel, Tina war erneut an Brustkrebs erkrankt. Aber Tina hielt sich einfach großartig. Ich fühlte mich dagegen richtig klein und schwach. Mir kam ein Traum in den Sinn aus der ersten Nacht unseres Urlaubes an der Elbe. Ich hatte geträumt, dass Tina schwer erkrankt sei und ich großen Ärger bei der Arbeit bekommen würde. Damals habe ich mich damit beruhigt, dass ich im Traum nur meine Ängste verarbeitet hatte. Nun gab es diese weitere Diagnose. Ich machte mir Vorwürfe, Tina immer beruhigt zu haben. Bei jeder Nachuntersuchung hatte ich gesagt: „Alles ist in Ordnung! Der Tumor ist hormonabhängig gewesen und kann nicht wiederkommen, weil die weiblichen Hormone durch die Antihormontherapie ausgeschaltet sind.“ Tinas vorzeitige Wechseljahrsbeschwerden wie Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen habe ich insofern verharmlost, als ich immer dachte: „Der Krebs kommt durch diese Therapie nicht wieder!“ Tina hatte dazu meist geschwiegen. Hin und wieder sagte sie: „Man kann sich auch alles schön Reden!“ Dann war ich etwas irritiert, ordnete es dann nur den Wechseljahrbeschwerden zu und beruhigte Tina gedankenlos weiter.
Aber am meisten habe ich wohl mich selbst damit beruhigen wollen.